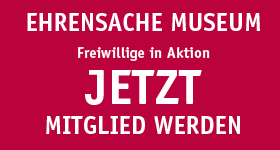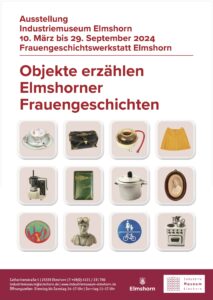Petroleumfass mit Pumpvorrichtung
Dieses Petroleumfass ist gut 100 Jahre alt und trägt den deutlichen Schriftzug „Eigentum der Deutsch-Amerikanischen-Petroleum-Gesellschaft“. Die DAPG war der deutsche Ableger der Standard Oil Company und hatte zahlreiche Petroleumhändler unter Vertrag. Sie lieferten die Behälter kostenlos gegen die Verpflichtung, das Petroleum nur von der DAPG zu beziehen. Zunächst wurde das Petroleum in Fässern oder Transportkannen mit dem Pferdefuhrwerk an die kleinen Läden geliefert, aber ab 1901 fuhr in Hamburg bereits der erste Tankwagen.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts löste die Petroleumlampe Tranfunzeln und Kerzen zunehmend ab. Das, was heute als schummriges Licht der „guten alten Zeit“ gilt, war seinerzeit aufgrund der Helligkeit revolutionär. Der Siegeszug der Petroleumlampe führte zu einem ersten „Ölfieber“. Einen legendären Ruf als „Ölkönig“ erwarb sich John D. Rockefeller in den USA, dessen Standard Oil Company ab 1870 nicht nur die Ölförderung, sondern auch die Verarbeitung zu Petroleum, den Transport und den Verkauf an den Endverbraucher organisierte und lange Zeit auch kontrollierte. Das Geschäft mit den amerikanischen Erdölprodukten boomte. Zur Petroleumlampe gesellten sich Petroleumofen und Petroleumkocher. Weitere Erdölerzeugnisse wie Asphalt und Teer veränderten Hausdächer und Straßen.
In den Elmshorner „Petroleum- und Seifenhandlungen“ konnte der Kunde Petroleum in seine mitgebrachte Kanne abfüllen lassen. Petroleumfässer mit Pumpvorrichtung standen ebenfalls bis Ende der 1920er Jahre in den Kolonialwarenläden, wie beispielsweise in dem Laden von Möller an der Ecke Gärtnerstraße/Gerhardstraße. Das im Industriemuseum Elmshorn im 2. Obergeschoss ausgestellte Petroleumfass stammt aus einem ländlichen Kolonialwarengeschäft aus den Elbmarschen. Alle vier bis fünf Wochen kam die „Deutsch-Amerikanische Petroleumgesellschaft“ und füllte das Fass wieder auf.
Die ersten Verbrennungsmotoren nutzten verschiedene Treibstoffe – darunter auch Petroleum. In der Anfangszeit des Benzinverkaufes füllte der Kraftfahrer beim Petroleumladen, im Kolonialwarenladen oder in der Drogerie den jeweiligen Treibstoff aus der Fasspumpe in eine Kanne und goss es dann mit Hilfe eines Trichters in den Tank des Automobils. Erst mit Zunahme des Automobilverkehrs entstanden die ersten Tankstellen, meist gekoppelt mit einer Autowerkstatt, die sich oft aus einer Schmiede oder Schlosserei entwickelt hat.
Inventarnummer: 1982-0019
Datierung: um 1910
Material: Blech, Kunststoff
Maße: 191 cm x 46 cm (hxd)
Hersteller: unbekannt
Standort: Industriemuseum Elmshorn